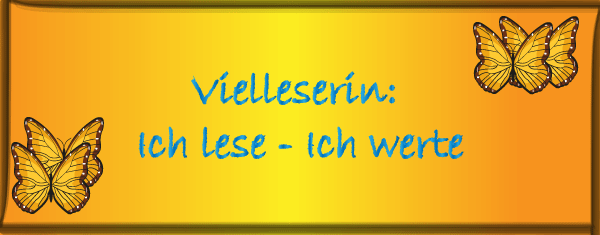vielleserin.de/wp-content/uploads/2025/08/7_Auf_d_Walz_Drei_Jahre_u_ein_Tag-1.webp” alt=”Auf der Walz – Drei Jahre und ein Tag” width=”1797″ height=”1001″ /> Zimmerin Maria (Ronja Rath, Mitte) möchte mit zur Walz aufbrechen und wird von den Wandergesellen begrüßt. © ARD Degeto Film/Constantin Television/Lemonpie Film/Petro Domenigg
Mit “Auf der Walz – Drei Jahre und ein Tag” zeigt das Erste heute Abend um 20.15 Uhr einen Film über die alte Handwerkstradition und eine junge Frau auf der Suche nach sich selbst.
Maria, Zimmerin und Tochter des Betriebsinhabers, bricht mit dem wandernden Gesellen Cem zu einer Walz auf, die ihre Vorstellungen von Beruf, Bindung und Freiheit radikal in Frage stellt. Regisseurin Sibylle Tafel inszeniert das ungleiche Duo als zarte, aber bestimmte Suche nach Identität; Ronja Rath und Sohel Altan Gol schaffen eine glaubwürdige emotionale Spannung.
Der geplante Lebensweg – Betrieb übernehmen, heiraten, Kinder – gerät ins Wanken, als Cem die absolute Unverbindlichkeit der Walz vorlebt und Maria sich zwischen Erwartung und Sehnsucht entscheiden muss.
Michael Kendas Drehbuch nutzt die jahrhundertealte Wanderschaftstradition, um moderne Fragen zu Geschlechterrollen und Selbstverwirklichung zu verhandeln, unterstützt von stimmungsvollen Bildern rund um Wien. Ergänzt durch Oliver Stokowski als besorgten Vater und Silas Breiding als verunsicherten Partner, bietet der Film eine behutsame Mischung aus Tradition, Selbstfindung und filmischer Ruhe.
Worum geht es bei “Auf der Walz – Drei Jahre und ein Tag”?
Ungewissheit ist der beste Plan! Mit diesem waghalsigen Motto stürzt sich die von Ronja Rath gespielte Zimmerin Maria, die in ihrem Heimatdorf einer allzu berechenbaren Zukunft ins Auge blickt, in das Abenteuer Walz. Begleitet wird sie von dem ebenso geheimnisvollen wie charismatischen Cem, gespielt von Sohel Altan Gol.
Regisseurin Sibylle Tafel setzt in ihrer leichthändigen Inszenierung auf die Gegensätzlichkeit des Duos, das für seinen gemeinsamen Weg erst einmal zusammenfinden muss. Das Drehbuch von Michael Kenda nutzt die auf den ersten Blick anachronistisch wirkende Handwerkstradition, um eine hochmoderne Geschichte über Selbstfindung, Geschlechterrollen und Lebensträume zu erzählen.
Noch nicht einmal 30 Jahre alt, doch schon scheint ihr weiterer Lebensweg festgelegt: Zimmerin Maria Abeler (Ronja Rath) soll den Betrieb ihres Vaters Volker (Oliver Stokowski) übernehmen und mit ihrem langjährigen Freund Steffen (Silas Breiding) eine Familie gründen. So stellen es sich jedenfalls die beiden Männer vor. Eigentlich dachte auch Maria, das sei ihr Weg. Doch dann taucht in der Zimmerei Cem (Sohel Altan Gol) auf, einer dieser lässigen Wandergesellen, die sich von Baustelle zu Baustelle treiben lassen, kein Gestern und kein Morgen kennen. Drei Jahre und einen Tag unterwegs, ohne Handy, ohne Verpflichtungen. Die absolute Freiheit! Aber auch: keine Familie, kein Zuhause – kein Steffen. Trotzdem fühlt Maria, dass sie das machen muss: auf die Walz gehen! Kurzentschlossen bricht sie mit Cem auf und lernt auf ihrer Wanderschaft nicht nur die Traditionen ihres Berufsstandes kennen. “Auf der Walz” erfährt sie ihre eigenen Grenzen, entdeckt aber auch unerwartete Stärken. Und eine Frage wird immer drängender: Wo will Maria wirklich ankommen?
“Auf der Walz – Drei Jahre und ein Tag”: Drehorte
Die Dreharbeiten zu “Auf die Walz gehen” fanden vom 8. August bis 6. September 2023 in Österreich statt. Dieser späte Sommerzeitraum prägt sichtbar den Film: lange, goldene Nachmittage, warme Abendstimmungen und eine Landschaft, die zwischen sanften Hügeln, Wälderinseln und traditionellen Ortschaften wechselt. Für uns Zuschauer erzeugt genau dieses natürliche Licht eine Stimmung, die zugleich bodenständig und ein wenig entrückt wirkt — ideal für eine Geschichte über Aufbruch und Selbstfindung, die ihre Energie aus kleinen, konkreten Momenten schöpft.
Die Auswahl der Drehorte rund um Wien erlaubt dem Film eine große Bandbreite visueller Stimmungen. In den Außenaufnahmen spüren wir die Weite der Landschaften und die physische Dimension der Walz: Wege, die sich verlieren, Handwerkstätten als Orte des Loderns und Schaffens, und Dörfer, die traditionelle Handwerkskultur noch atmen. Innenräume, etwa die Zimmerei und einfache Herbergen, kontrastieren dazu mit einer rauen Intimität; hier wird das Verhältnis der Figuren zueinander unmittelbar und greifbar. Zusammen erzeugen diese Schauplätze ein dichtes Geflecht aus Vertrautem und Fremdem, das die innere Reise der Protagonistin nicht nur erzählt, sondern fühlbar macht.
Technisch war der Drehzeitraum günstig: Spätsommerliches Wetter ermöglichte reale Außenaufnahmen ohne viele Tricks, was dem Film eine handfeste, fast dokumentarische Präsenz verleiht. Gerade in einer Erzählung über handwerkliche Traditionen wirkt diese Sichtbarkeit von Materialität — Holz, Werkzeuge, Staub, Sonnenlicht auf Brettern — besonders kraftvoll. Für uns als Publikum bedeutet das: Wir sehen nicht nur eine Metapher von Freiheit, wir spüren ihre physische Anstrengung und das taktile Vergnügen handwerklicher Arbeit.
Die kompakte Drehzeit von knapp einem Monat hat dem Film eine gewisse Verdichtung gegeben. Viele Szenen profitieren von einem unaufgeregten Tempo, das den Rhythmus der Wanderschaft nachempfindet: Tage voller Arbeit, Nächte voller Gespräche, kurze Begegnungen am Wegesrand. Diese Produktionsentscheidung macht den Film zugänglich und direkt — er verlangt von uns kein literarisches Entrinnen, sondern lässt uns in die Atmosphäre eintreten und dort verweilen. So bleibt die Reise der Figuren primär ein sinnliches Erlebnis: Wir hören das Klopfen der Hämmer, sehen den Staub in der Sonne, spüren die Spannung zwischen Bindung und Aufbruch.
Kurz gesagt: Die Drehdaten und -orte haben “Auf die Walz gehen” nicht nur logistisch ermöglicht, sie haben die Erzählung geerdet. Die österreichischen Sommerlandschaften und handwerklichen Settings formen eine Atmosphäre, die uns als Zuschauer sowohl nostalgisch berührt als auch Gegenwartsfragen scharf stellt — Fragen nach Freiheit, Verantwortung und dem, was es bedeutet, an einem Ort wirklich anzukommen.
“Auf der Walz – Drei Jahre und ein Tag”: Besetzung
Die Besetzung von “Auf der Walz – Drei Jahre und ein Tag” überzeugt durch eine kluge Mischung aus erfahrenen Charakterdarstellern und jungen Talenten, die gemeinsam eine dichte, authentische Atmosphäre schaffen.
An der Spitze steht Ronja Rath als Maria Abeler, deren Präsenz im Film eine zentrale Rolle spielt. Sie bringt eine Natürlichkeit und Emotionalität mit, die uns als Zuschauer direkt abholt und in die Welt der Walz eintauchen lässt. Neben ihr ergänzt Sohel Altan Gol als Cem Zimmerer das Ensemble mit einer zurückhaltenden, aber spürbar intensiven Darstellung, die den Filmboden festigt.
Mit Silas Breiding als Steffen Hegel und Oliver Stokowski in der Rolle des Volker Abeler sind zwei weitere starke Persönlichkeiten besetzt, die das Drama um Familie und Tradition glaubwürdig und nuanciert tragen. Gerade Stokowski verleiht seiner Figur eine eindrucksvolle Tiefe, die dem Film immer wieder neue emotionale Schichten hinzufügt.
Das Ensemble wird durch Schauspieler wie Caroline Frank (Susanne) und Jutta Fastian (Frau Rickel) bereichert, die kleinere, aber wesentliche Rollen mit großer Authentizität ausfüllen. Besonders bemerkenswert ist auch die Leistung von Inge Maux als Gerti, deren Erfahrung spürbar dazu beiträgt, die dörfliche Welt lebendig und greifbar zu machen.
Auf der Seite der männlichen Nebenrollen fallen Martin Bermoser (Andreas), Arthur Klemt (Rudi) und Eugen Pirvu (Eugen) mit ihrem zurückhaltenden Spiel auf, das nie überzeichnet wirkt, sondern subtil zur Gesamtdynamik beiträgt. Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist C.C. Weinberger als Grabowski, der mit seiner Präsenz für zusätzliche Spannung sorgt.
Die kleinen, aber prägnanten Auftritte von Rainer Doppler (Wirt) und Vanessa Payer Kumar (Bürgermeisterin) runden das Bild eines Dorfes ab, das mit all seinen Eigenheiten lebendig wird – hier entsteht eine Welt, die man fast riechen und fühlen kann.
Insgesamt gelingt es dem Film durch diese Besetzung, eine dichte Stimmung aufzubauen, die nicht nur die Handlung trägt, sondern auch uns als Zuschauer tief in die Lebensrealität der Figuren versinken lässt. Es ist ein Ensemble, das nicht auf große Gesten setzt, sondern durch präzise Nuancen überzeugt und so ein authentisches, berührendes Porträt zeichnet. Man spürt die Vertrautheit unter den Darstellern, was den Film zu einem atmosphärisch starken Erlebnis macht – ganz ohne übertriebene Effekte oder Pathos. So schafft es “Auf der Walz – Drei Jahre und ein Tag”, uns nicht nur zu unterhalten, sondern auch zum Nachdenken einzuladen.
“Auf der Walz – Drei Jahre und ein Tag”: Identifikationspotenziale
Als Zuschauerin spüre ich sofort, warum Maria so viele von uns erreicht: sie steht genau an der Schwelle, an der wir uns selbst immer wieder ertappen. Diese Frau, die einerseits Pflichten erfüllt und andererseits ein leises Verlangen nach Aufbruch in sich trägt, ist keine Ausnahmefigur, sondern eine Projektion alltäglicher Zwiespälte.
Wer von uns kennt nicht das Gefühl, anderen gerecht werden zu wollen — dem Elternhaus, dem Partner, dem sicheren Job — und dabei die eigene Stimme leise zu übergehen? Gerade deshalb funktioniert Marias Entscheidung, in dem Film “Auf die Walz gehen” aufzubrechen, als emotionaler Katalysator.
Warum Marias Zwiespalt so glaubwürdig wirkt und welche Fragen er bei dir auslöst
Marias Zwiespalt wirkt glaubwürdig, weil er aus dem Alltäglichen stammt: frühe Verantwortungsübernahme, die Erwartung, familiäre Rolle zu erfüllen, und die Versuchung, persönliche Sehnsüchte hintanzustellen. Als Zuschauerin wirst du nicht mit psychologischen Schlagworten zugeschüttet, sondern erlebst Schritt für Schritt, wie sich diese inneren Konflikte in konkreten Entscheidungen materialisieren.
Das löst Fragen aus, die nicht abstrakt bleiben: Wie sehr prägt die Sorge um andere meine eigenen Lebensentwürfe und wann ist der richtige Zeitpunkt, etwas zu verändern? In “Auf die Walz gehen” beantwortet sich das nicht final, aber der Film zeigt, dass Veränderung oft mit einem neugierigen Ja zu einer ungewohnten Möglichkeit beginnt.
Die Ambivalenz von Freiheit — was du von Cem lernen kannst und wo die Grenzen liegen
Cems Lebensentwurf wirkt attraktiv, weil er Einfachheit und Klarheit verspricht: wenige Besitztümer, klare Regeln und direkte Rückmeldung. Gerade in einer Zeit, in der viele Zuschauerinnen und Zuschauer die Balance zwischen Kontrolle und Autonomie hinterfragen, fungiert Cem in “Auf die Walz gehen” als Versuchsanordnung zur Selbstbestimmung.
Die Antwort des Films ist ambivalent: Du siehst die Vorzüge, aber auch die Einsamkeit, das fehlende soziale Netz und die praktischen Risiken eines solchen Lebensstils. Daraus ergibt sich für dich die Frage, ob ein gemischter Weg möglich ist — Autonomie innerhalb von Bindungen — und wie viel Kompromissbereitschaft persönliche Freiheit erfordert.
Loslassen als Lernprozess — wie Volkers Angst dich etwas über Erziehung lehrt
Volker ist kein Klischee des überfürsorglichen Vaters, sondern eine differenzierte Figur, deren Alleinverantwortung Bindungen geschmiedet hat, die nun zur Falle werden können. Für dich liegt die Lehre in der Nuancierung: Loslassen ist kein einmaliger Akt, sondern ein Prozess des Vertrauensaufbaus und der inneren Umstellung. “Auf die Walz gehen” zeigt, wie schrittweise Distanz möglich wird — durch Gespräche, Anerkennung von Kompetenz und das Akzeptieren, dass Liebe nicht gleich Kontrolle ist. Daraus ergeben sich praktische Fragen: Wie unterstütze ich Entwicklung, ohne zu überprotektieren, und wie erkenne ich, wann Sorge hemmend wird?
Walz als kulturelles Instrument — was die Tradition dem modernen Leben bietet
Die Walz ist im Film mehr als folkloristische Kulisse; sie fungiert als struktureller Übersetzungsraum für soziale und berufliche Reifung. Du wirst als Zuschauerin Zeugin, wie handwerkliche Praxis, Disziplin und neue Begegnungen in kurzer Zeit zu innerer Entwicklung führen.
Die Regie zeigt, dass Traditionen Halt geben können, weil sie Erfahrungen standardisieren und vergleichbar machen, ohne veraltet zu wirken. So entsteht die Frage, welche Rituale in deinem Leben Struktur bieten und ob bewusst eingelegte Auszeiten ähnliche Wirkungen erzielen könnten.
Praktische Übertragbarkeit: Welche Schritte du für dich aus Marias Weg ableiten kannst
“Auf der Walz – Drei Jahre und ein Tag” liefert keine Patentrezepte, bietet aber ein Modell von kleinen Experimenten statt radikaler Flucht. Marias Wandel entsteht aus vielen kleinen Entscheidungen — Zuhören, Weitermachen trotz Zweifel und Lernen von anderen — und nicht aus einem einzigen dramatischen Ereignis.
Wenn du dich angesprochen fühlst, kannst du fragen, welche Mini-Walz sich in deinen Alltag integrieren lässt: ein Sabbatical, ein anderes Arbeitsprojekt oder Wochenenden mit radikalem Perspektivwechsel. So bleibt Veränderung erreichbar, ohne alles auf eine Karte setzen zu müssen.
Bildsprache und Wirkung: Warum Landschaft und Ton deine Reflexionen vertiefen
Die Wahl, die Wanderschaft in wechselnden Landschaften um Wien zu platzieren, ist mehr als ästhetisch; Raum wird im Film als psychologischer Katalysator genutzt. Offene Felder lassen Entscheidungen größer wirken, enge Arbeitsumfelder hingegen zeigen Verantwortungsdichte und Begrenzung.
Die leichthändige Inszenierung verhindert, dass Figuren zu Symbolen werden, und erhält ihre Menschlichkeit mit Widersprüchen. Das führt zu einer zentralen Überlegung: Wie sehr braucht Veränderung einen äußeren Ort, um innerlich möglich zu werden — Ortswechsel können Umdenken erleichtern, ersetzen aber nicht die persönliche Arbeit.
Wenn du “Auf die Walz gehen” siehst, nimm dir Zeit für die leisen Momente, denn sie sind die eigentlichen Entscheidungspunkte. Achte auf Dialoge, die mehr andeuten als aussprechen, und auf Blicke, die innere Richtungswechsel vorwegnehmen. Die Tradition der Walz ist im Film kein exotisches Beiwerk, sondern ein Spiegel für moderne Lebensfragen, der dich einlädt, deine eigenen Grenzen und Sehnsüchte neu auszutarieren.
Erwartungen an “Auf der Walz – Drei Jahre und ein Tag”
Ich erwarte von “Auf der Walz – Drei Jahre und ein Tag” eine leise, atmosphärisch dichte Erzählung, die die Walz als strukturierendes Element für Marias innere Wandlung nutzt. Ronja Rath und Sohel Altan Gol bilden für mich das emotionale Zentrum; die Bildsprache — spätsommerliches Licht, Holz, Staub — macht die Arbeit und die Entscheidung spürbar. Das ruhige Tempo zeigt Veränderung als Serie kleiner Schritte statt dramatischen Bruchs und lädt zur Reflexion über Freiheit, Bindung und Verantwortung ein.
Sieh dir “Auf der Walz – Drei Jahre und ein Tag” an und kommentiere deine Meinung: Hat Marias Weg bei dir etwas ausgelöst? Teile deine Eindrücke hier oder in den sozialen Medien.