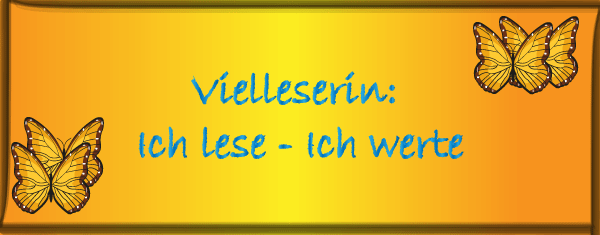Eric (Ulrich Brandhoff, li.) ahnt, wo Tanja sich vertseckt hat und teilt dies Sabine Wagner (Isabell Gerschke, re.), Lore (Birgit Berthold, 2. v. li.), Paul (Christoph Schechinger, Mitte) und Helga (Hildegard Schroedter) mit.© ARD Degeto Film/Oliver Feist
Käthe und ich – Ein gutes Leben” läuft heute um 20:15 Uhr im Ersten: Ein leiser, eindringlicher Film über Würde, Stolz und das, was im Alter schnell zerbrechlich werden kann.
Paul Winter (Christoph Schechinger) entdeckt beim Spaziergang mit Therapiehündin Käthe seine ehemalige Klavierlehrerin Lore Lehmann (Birgit Berthold) beim Pfandflaschen-Sammeln – ein Bild, das so gar nicht zu der geachteten Frau passt, die er kannte. Aus Sorge und Anteilnahme holt Paul Lore auf den Gutshof seiner Familie, gibt ihr Zuflucht unter dem Vorwand, seine Mutter wolle Klavierspielen lernen, und läutet damit einen Prozess der behutsamen Annäherung ein. Käthe übernimmt dabei die Rolle, die der Film sensibel ausspielt: nicht als Rettungsengel, sondern als Brücke zu menschlicher Nähe und Vertrauen.
Doch die Annahme, mit Fürsorge allein ließe sich alles richten, erweist sich als Trugschluss. Alte Gerüchte und ein Diebstahlvorwurf, inszeniert von Sabine Wagner (Isabell Gerschke) gegen Lore, bedrohen nicht nur ihren Ruf, sondern auch das fragile Gleichgewicht, das Paul mühsam wiederherzustellen versucht. Die Geschichte stellt die Frage nach Verantwortung: Wie weit darf man eingreifen, wenn Respekt vor der Autonomie der anderen mit dem Bedürfnis zu helfen kollidiert? Pauls Abwägungen führen ihn an moralische und emotionale Grenzen.
Birgit Berthold liefert eine zurückhaltende, kraftvolle Darstellung einer Frau, die ohne Pathos ihre Würde verteidigt; Christoph Schechinger spielt den Psychologen, der mehr lernt als er zu Beginn vermutet, und Hoonah als Käthe schafft es erneut, Szenen mit einer fast schon filmischen Intuition zu tragen. Regie und Drehbuch (Oliver Liliensiek, Brigitte Müller) vermeiden plumpe Moralisierungen und erzählen stattdessen nuanciert von einem sozialen Problem, das viele betrifft: die Facetten von Altersarmut, Scham und dem Alltag, in dem kleine Gesten große Wirkung zeigen.
Wer auf fein gezeichnete Figuren, ruhige Kameraführung und eine Geschichte setzt, die nachklingt, findet in “Ein gutes Leben” einen Film, der bewegt ohne zu übertreiben und zum Nachdenken anregt.
Worum geht es bei “Käthe und ich – Ein gutes Leben”?
Wer sein ganzes Leben gut für sich und andere gesorgt hat, tut sich mit Altersarmut besonders schwer. Mit diesem Tabuthema sieht sich Hauptdarsteller Christoph Schechinger im 11. Film von “Käthe und ich” konfrontiert. Zusammen mit der vierbeinigen Titelheldin hilft der einfühlsame Psychologe einer Seniorin, die aus Stolz und Scham in die Obdachlosigkeit abdriftet.
In der Episodenrolle zeigt die renommierte Film- und Theaterdarstellerin Birgit Berthold eine eindrucksvolle Schauspielleistung. Regisseur Oliver Liliensiek verfilmt mit Feingefühl das lebensnahe Drehbuch von Brigitte Müller, die eine berührende Geschichte über Würde und innere Stärke erzählt. Eine entscheidende Rolle nimmt die Australian-Shepherd-Therapiehündin Käthe ein.
Der Psychologe Paul Winter (Christoph Schechinger) macht bei einem Spaziergang mit Therapiehündin Käthe eine verstörende Beobachtung: Seine ehemalige Klavierlehrerin Lore Lehmann (Birgit Berthold) sucht im Müll nach Pfandflaschen. Die einst angesehene Frau versucht, ihre Notlage zu verbergen – doch der Anblick lässt Paul nicht los.
Nach Gesprächen mit seiner Mutter Helga (Hildegard Schroedter) und seinem besten Freund Eric (Ulrich Brandhoff) wird ihm klar: Lore ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten, hat ihre Wohnung verloren und musste sogar ihren geliebten Hund Klaus abgeben. Unter dem Vorwand, dass seine Mutter Klavierspielen lernen möchte, lädt Paul sie auf den mecklenburgischen Gutshof ein.
Käthe tut, was sie am besten kann: Lore Lehmann durch die schwere Zeit helfen. Indes erfährt Paul von dunklen Gerüchten. Die resolute Sabine Wagner (Isabell Gerschke), deren Tochter Tanja (Cléo Buzási) eine ehemalige Schülerin ist, wirft Lore vor, sie bestohlen zu haben.
Das hat für Lore schwerwiegende Folgen, denn ihre Kunst lebt auch von ihrem Ruf. Paul weiß, dass es Zeit braucht, um Vertrauen aufzubauen, denn um zu unterstützen und gleichzeitig die Wahrheit herauszufinden, muss er sehr behutsam vorgehen …
“Käthe und ich – Ein gutes Leben”: Drehorte
Die Dreharbeiten zu “Kathe und ich – Ein gutes Leben” vom 4. Oktober bis 1. November 2024 in Waren an der Müritz, Röbel und Berlin geben dem Film einen spürbaren Atem. Der kompakte Zeitrahmen erlaubte konzentrierte, atmosphärische Einstellungen: spätherbstliches Licht, kühle Luft und kurze Drehtage formen die Bildästhetik.
Waren an der Müritz liefert die stille, introspektive Grundstimmung. Der Neue Markt, die gotischen Kirchen und die Fachwerkhäuser geben dem Bild Geschichte und Vertrautheit. Die Nähe zur Müritz und zum Nationalpark macht sich in jedem Frame bemerkbar: Uferpartien, gedämpfte Farben und feuchte Luft lassen Szenen atmen und verstärken inneres Erleben ohne Worte.
Röbel bringt intime, alltagsnahe Texturen. Der historische Hafen, das knarzende Hafenholz und enge Gassen verankern Figuren glaubwürdig. Im diffusen Herbstlicht gewinnen kleine Gesten Gewicht; Details wie Boote am Steg oder Haustüren werden zu emotionalen Ankern, die beim Zuschauen nachhallen.
Berlin fungiert als scharfer Gegenpol. Neonlicht, Verkehr und dichte Architektur treiben das Tempo und erhöhen die visuelle Spannung. Die Stadt erzeugt Nervosität und Anonymität, setzt Kontraste zu Seenruhe und Kleinstadtidylle und verändert sofort Rhythmus und Tonalität der Erzählung.
Gemeinsam formen die Orte eine sinnliche Landkarte: die Ruhe und historische Tiefe von Waren, die Hafenromantik und Alltagsnähe in Röbel, die elektrische Hektik Berlins. Diese Schichtung bestimmt nicht nur das Was der Geschichte, sondern vor allem das Wie — wie sich Szenen anfühlen, wie Emotionen spürbar werden.
“Käthe und ich – Ein gutes Leben”: Besetzung
Die Besetzung von “Käthe und ich – Ein gutes Leben” funktioniert weniger als Starensemble denn als präzise aufeinander eingespieltes Kollektiv. Gemeinsam tragen die Figuren die Atmosphäre des Films und machen Gefühlslagen für uns als Zuschauer sichtbar.
Christoph Schechinger gibt dem Film mit seiner Darstellung des Paul Winter die nötige Ruhe. Sein Spiel ist zurückhaltend, fein austariert: Schechinger lässt Pauls Stillstand und innere Konflikte in kleinen Gesten erscheinen, nicht in großen Reden. In “Käthe und ich – Ein gutes Leben” wird Paul so zur Projektionsfläche, an der wir unsere eigenen Zwischentöne ablesen können.
Hoonah als Hund Käthe führt überraschend viel Erzählkraft mit sich. Als therapeutischer Begleithund ist Käthe mehr als bloßer Sidekick: Durch Blick, Körperhaltung und Präsenz verstärkt sie intime Momente, schafft Nähe und löst gelegentlich Spannung. Ihre Anwesenheit macht Szenen greifbarer und gibt dem Film emotionale Anker.
Ulrich Brandhoff als Eric bringt eine rauere Textur ins Ensemble. Er füllt die Rolle mit einer kontrollierten Härte, die nicht überzogen wirkt. In “Käthe und ich – Ein gutes Leben” sorgt Brandhoffs Präsenz für subtile Reibung, die das Beziehungsgefüge nuanciert, ohne aufdringlich zu werden.
Hildegard Schroedter verleiht Helga Winter Wärme und Glaubwürdigkeit. Ihr Spiel ist geerdet; sie kann tröstlich und kritisch zugleich sein. Diese Bandbreite gibt dem Familienskelett des Films Halt und verhindert, dass die Figuren in Stereotype abrutschen.
Anna Hausburg als Jasmin bringt direkte Energie ins Geschehen. Ihre Natürlichkeit und ihr Timing verschieben die emotionale Temperatur einzelner Szenen, sodass kleine Impulse große Wirkung entfalten. Hausburg sorgt für Bewegung dort, wo der Film sonst verharren könnte.
Birgit Berthold als Lore Lehmann repräsentiert das Alltägliche, das dennoch wichtig ist. Mit unaufgeregter Präsenz macht sie Lebensrealitäten fühlbar — eine Eigenschaft, die in “Käthe und ich – Ein gutes Leben” die leisen Momente trägt.
Isabell Gerschke als Sabine Wagner setzt oft emotionale Akzente. Ihr Spiel balanciert Nähe und innere Spannung, wodurch ihre Szenen immer wieder als Katalysatoren fungieren. Gerschke bringt Energie, die nicht lauter wird, sondern punktuell zündet.
Cléo Buzasi als Tanja Wagner liefert eine nervöse, frische Note. Ihre Darstellung ist modern und glaubwürdig; sie treibt Konflikte an, ohne Effekthascherei. Buzasis Präsenz hält das Ensemble jugendlich und lebendig.
Victor Maria Diderich als Timo setzt einen kantigen Kontrapunkt. Als jüngerer Darsteller bringt er Bewegungsfreude und Unruhe, die Erwartungen infrage stellt und so Spannungsverschiebungen auslöst. In “Käthe und ich – Ein gutes Leben” wirkt Timo wie ein Impulsgeber.
In der Gesamtschau ergibt sich so ein Ensemble, das nicht durch einzelne Stars besticht, sondern durch die Summe kleiner, präziser Nuancen. “Käthe und ich – Ein gutes Leben” lebt von dieser Zurückhaltung: Die Stimmung hallt nach, weil das Spiel ehrlich bleibt und uns als Zuschauer den Raum lässt, selbst zu empfinden.
So thematisiert der Film Altersarmut und Würde
In der Episode “Ein gutes Leben” der Reihe “Käthe und ich” begegnen wir Altersarmut als persönlich erfahrbare Realität. Kleine, präzise Bilder — Pfandflaschen, verschlossene Hilfsangebote, das Verbergen der Not — machen die Lage von Lore Lehmann unmittelbar nachvollziehbar.
Lore ist keine eindimensionale Opferfigur, sondern das Ergebnis eines Lebenslaufs: lange Pflegezeiten, kontinuierliche Arbeit und am Ende eine Rente, die nicht ausreicht. Dadurch verschiebt sich der Fokus von Schuldzuweisungen auf die Frage, wie Würde erhalten werden kann. Pauls behutsames Eingreifen zeigt, dass Respekt oft im Kleinen beginnt: Zeit schenken, zuhören und nicht bevormunden.
Der Film verzichtet auf einfache Lösungen und bleibt nüchtern und einfühlsam. Er regt dazu an, über Stolz, Scham und Verantwortung nachzudenken und macht deutlich, dass individuelle Fürsorge strukturelle Probleme nicht allein ausräumen kann.
Glaubwürdigkeit und soziale Ursachen: Warum Lore so leben muss
Die Erzählung bleibt eng an realen Ursachen wie Pflegebelastung, Einkommenseinbußen und fehlender privater Vorsorge. Diese faktische Basis verleiht der Episode Plausibilität und verhindert moralische Vereinfachungen.
Die Darstellung zeigt, wie Strukturen private Existenzen untergraben können, und macht deutlich, dass individuelle Schicksale in einen politischen und sozialen Kontext eingebettet sind. Dadurch entsteht für das Publikum ein nachvollziehbares Bild von Ursachen und Verantwortlichkeiten.
Konkrete Unterstützungsdefizite und ihre filmische Darstellung
Der Film deutet an, welche Hilfen Lore benötigt hätte: verlässliche Pflegeentlastung, rechtliche Beratung bei Verlust des Wohnraums und eine angemessene Rentenbasis. Pauls kurzfristige Hilfe wirkt notwendig, bleibt aber unvollständig und hebt hervor, wie sehr langfristige Absicherung fehlt.
Diese Konzentration auf einzelne Lücken macht das Problem greifbar, ohne in Vereinfachungen zu verfallen, und zeigt zugleich, dass strukturelle Interventionen nötig wären, um ähnliche Fälle nachhaltig zu verhindern.
Ethische Spannung: Hilfe bewahren oder Autonomie respektieren
Pauls Vorgehen, Lore unter einem Vorwand auf den Gutshof zu holen, ist moralisch ambivalent, weil es ihren Stolz schützt und gleichzeitig ihre Entscheidungsfreiheit einschränkt. Der Film lässt diese Spannungsfelder offen und behandelt sie differenziert.
Die Episode fordert dazu auf, die Balance zwischen Schutz und Selbstbestimmung ernst zu nehmen und verdeutlicht, dass solche Entscheidungen Empathie, Reflexion und Rücksicht auf langfristige Folgen erfordern.
Beziehung und Vertrauen: Mensch–Tier-Dynamik als Erzählmotor
Käthe ist in “Käthe und ich – Ein gutes Leben” weit mehr als eine Begleiterin; sie ist ein emotionaler Zugang, der Momente ermöglicht, die Worte oft umgehen. Ihre Präsenz schafft Räume, in denen Nähe schrittweise wachsen kann und in denen nonverbale Kommunikation belastete Menschen erreicht.
Lore reagiert auf Käthe, bevor sie Menschen vertraut; diese langsame Öffnung ist plausibel, weil sie in wiederkehrenden Ritualen entsteht und nicht durch dramatische Wendungen erzwungen wird. Dadurch entsteht eine glaubwürdige Entwicklung, die ohne Sentimentalität auskommt.
Vertrauen entfaltet sich in dieser Darstellung als Prozess, getragen von Vorhersehbarkeit, wiederholten positiven Erfahrungen und kleinen Stabilitätsritualen. Rückschläge gehören dazu, was die psychologische Darstellung realistisch macht.
Filmische Ökonomie: Nonverbales als erzählerisches Mittel
Die Regie nutzt Käthe, um nonverbale Wahrheiten zu vermitteln; Blickkontakte, ruhige Berührungen und situative Präsenz ersetzen oft erklärende Dialoge. Diese Verdichtung spart Erzählzeit und verstärkt zugleich die emotionale Wirkung der Szenen.
Dadurch entsteht eine filmische Ökonomie, in der das Bild mehr sagt als Worte, und die Figurenbeziehungen an Glaubwürdigkeit gewinnen, ohne in Pathos zu verfallen.
Psychologische Mechanik des Vertrauensaufbaus: Erkenntnisse für den Alltag
Der Vertrauensaufbau zwischen Lore und Käthe folgt belastbaren psychologischen Prinzipien: sichere Wiederholungen, verlässliches Verhalten und kleine Rituale, die Sicherheit vermitteln. Heilung verläuft nicht linear, sondern in Schritten mit Rückschlägen und Fortschritten.
Für Angehörige und Fachleute bedeutet dies, dass Stabilität durch Geduld und konstant gezeigte Zuwendung entsteht, nicht durch einmalige Großgesten, und dass respektvolle, vorhersehbare Routinen wesentlich sind.
Integration tiergestützter Therapieerkenntnisse: Relevanz für Praxis und Erzählung
Die Darstellung von Käthe entspricht Erkenntnissen aus der hundegestützten Therapie, nach denen Hunde als emotionaler Resonanzpartner wirken, Stress reduzieren und Offenheit fördern. Physiologische Effekte wie eine mögliche Cortisolreduktion und psychische Effekte wie verbesserte Emotionsregulation werden im Film durch ruhige Begegnungen und Berührungen angedeutet.
Käthes Rolle veranschaulicht reale Einsatzfelder: Beziehungsaufbau, Emotionsregulation und Motivation. Die Episode nutzt diese Mechanismen sorgfältig, ohne die Anwesenheit des Hundes als Allheilmittel zu inszenieren.
Wirkmechanismen und Grenzen: Forschung trifft Erzählung
Empirische Studien nennen mehrere Wirkpfade: physiologische Beruhigung, gesteigerte Kommunikationsbereitschaft, Übung sozialer Fertigkeiten und emotionale Spiegelung. Die Episode visualisiert diese Effekte durch einfache, wiederkehrende Interaktionen zwischen Lore, Paul und Käthe.
Gleichzeitig macht der Film die Grenzen des Ansatzes deutlich: Tiergestützte Maßnahmen können psychischen Halt bieten und therapeutische Prozesse fördern, sie lösen jedoch nicht strukturelle Probleme wie finanzielle Not oder rechtliche Benachteiligungen.
Praktische Schlussfolgerungen für Fachleute und Angehörige
Für Fachleute zeigt die Folge, wie tiergestützte Elemente wirkungsvoll in Therapieabläufe integriert werden können, sofern Auswahl, Ausbildung und Ablaufplanung professionell geregelt sind. Für Angehörige demonstriert der Film, dass Tiere oft als Türöffner fungieren und kommunikative Barrieren überwinden helfen, zugleich aber Verantwortung gegenüber Mensch und Tier besteht.
Professioneller Einsatz erfordert Ethik, Hygiene, klare Grenzen und kontinuierliche Evaluation, damit positive Effekte eintreten und Risiken minimiert werden.
Abschließend verknüpft “Ein gutes Leben” in der Reihe “Käthe und ich” soziale, ethische, filmische und therapeutische Perspektiven zu einer stimmigen Chronologie: von der konfrontativen Entdeckung über behutsame Intervention bis zum langsamen Wiederaufbau von Vertrauen. Für das Publikum entsteht ein differenziertes Verständnis von Lores Not, von Pauls Dilemma und von der leisen Wirkkraft einer Mensch–Tier-Beziehung, die sowohl filmisch als auch in der Praxis bedeutsam sein kann, sofern sie in professionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen eingebettet bleibt.
Erwartungen an “Käthe und ich – Ein gutes Leben”
Der Film “Käthe und ich – Ein gutes Leben” ist ein leiser, sorgfältig komponierter Beitrag, der Altersarmut, Würde und die Zerbrechlichkeit sozialer Reputation ohne moralische Vereinfachungen beleuchtet. Er verzichtet auf pathetische Zuspitzungen und setzt stattdessen auf Nähe und Beobachtung, sodass das Thema eindringlich und glaubwürdig wirkt.
Die Stärke liegt im Ensemble: Birgit Berthold macht die Verletzlichkeit und innere Standhaftigkeit ihrer Figur unmittelbar spürbar, Christoph Schechinger zeichnet die moralischen Gratwanderungen eines Helfenden mit feinen Gesten, und Hoonah als Käthe funktioniert als verlässlicher Beziehungsöffner. Gemeinsam erzeugen sie eine Atmosphäre, in der kleine Momente große Wirkung entfalten.
Der Film zeigt, wie tiergestützte Präsenz Vertrauen ermöglicht und nonverbale Zugänge öffnet, macht aber zugleich deutlich, dass solche Ansätze strukturelle Probleme nicht lösen. Diese doppelte Lesart vermeidet Simplifikationen: Emotionale Hilfe wirkt, bleibt aber Ergänzung zu notwendigen gesellschaftlichen Maßnahmen.
Formal besticht die Episode durch ökonomisches Erzählen: ruhige Bilder und gezielte Details ersetzen erläuternde Dialoge. Die Wahl der Drehorte schafft sinnliche Kontraste — Seenruhe versus Großstadt — und verstärkt so dramaturgisch die inneren Befindlichkeiten der Figuren.
In der Summe bietet “Ein gutes Leben” keinen schnellen Trost, sondern einen differenzierten Impuls: Er regt zur Reflexion über Mitgefühl, Verantwortung und die Pflicht zu struktureller Absicherung im Alter an. Der Film bleibt nachwirkend, weil er Fragen stellt, statt Antworten vorzuzeigen.
Käthe und ich - Ein gutes Leben

Regisseur: Oliver Liliensiek; Brigitte Müller
Erstellungsdatum: 2025-09-19 20:15
4.5
Vorteile
- Feinfühlige Regie
- Zurückhaltende, nuancierte Schauspielerleistungen
- Starke, unpathetische Darstellung von Würde
- Glaubwürdige Sozialkritik (Altersarmut, Pflegebelastung)
- Tiergestützte Szenen als glaubwürdiger Beziehungsöffner
- Filmische Ökonomie: nonverbale Verdichtung
- Sinnliche Drehortschichtung (Seenruhe vs. Stadt)
- Respektvolle Handhabung ethischer Dilemmata
- Subtile Spannung durch Gerüchte- und Rufkonflikt
- Nachklingende Wirkung; kein einfacher Trost
Nachteile
- Begrenzte narrative Lösungskompetenz (strukturelle Probleme bleiben offen)
- Gefahr der Verlangsamung für Zuschauer, die Tempo erwarten
- Moralisch ambivalente Täuschung (Vorwand zur Aufnahme) könnte polarisieren
- Risiko, tiergestützte Wirkung als zu prominent zu lesen
- Begrenzter Raum für Nebenfiguren-Entwicklung
- Potenzial für Missverständnisse bei rechtlichen/ethischen Details
- Künstlerische Zurückhaltung kann als Distanz empfunden werden
- Weniger spektakulär: geringere Massentauglichkeit